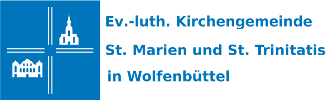Die Geschichte der Kirche St. Trinitatis in Wolfenbüttel
Die Geschichte der Kirche St. Trinitatis in Wolfenbüttel
Die Geschichte der Kirche St. Trinitatis in Wolfenbüttel ist recht komplex. Sie reicht von einer Vorstadtkirche über das Kaisertor als Notlösung bis hin zur bedeutendsten Barockkirche Deutschlands.
Diese Geschichte soll im Folgenden dargestellt und beschrieben werden. Das Material dazu entstammt diversen Dokumenten und Veröffentlichungen, die zumindest teilweise noch im Handel erhältlich sind.
Der Beginn in der Vorstadt: Die Kirche im Gotteslager

Im Rahmen der planmäßigen Erweiterung der Heinrichstadt in Richtung Osten durch Herzog Julius wurde im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts das sogenannte Gotteslager errichtet. Während der Stadtkern in dieser Zeit befestigt wurde, blieb das Gotteslager vor dem Kaisertor, das 1570 bis 1578 von Cort Mente erbaut wurde, relativ ungeschützt. Es entstanden auch andere Tore: das Mühlentor, das Dammtor, das Löwentor und das Liebfrauentor, aber das Kaisertor hatte bis etwa 1600 eine Vorrangstellung. Mit seinen Maßen von 34x26 Metern war es ein gewaltiger Bau.
Das Kaisertor hatte zwei Stockwerke. Während im Untergeschoss die Wachmannschaften Unterkunft fanden, wurde im Obergeschoss das geistliche Hofgericht gehalten.
Nach dem dreißigjährigen Krieg verlor das Tor seine Bedeutung, und die neuen Tore im Süden (Harztor) und nach Norden (Herzogtor) machten es bald nutzlos. Vor dem Tor war das sogenannte "Gotteslager" (heute "Juliusstadt) entstanden, das eigentlich als groß angelegte Stadtanlage von Herzog Julius geplant war. Aber der dreißigjährige Krieg führte zur Zerstörung der meisten Bauten - am Ende waren nur 12 Häuser übrig. Die Gemeinde, die sich dort versammelte, brauchte allerdings ein eigenes Gotteshaus, das gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch in der Gegend des Cornelius- oder Garnisonsberges gebaut wurde. Die Kirche entstand als Fachwerkbau mit einem Dachreiter, der die einzige Glocke trug. In weitem Umkreis war es der erste protestantische Kirchenbau und darum von besonderer Bedeutung.
Doch auch die Kirche wurde abgerissen, als das Gotteslager den Kanonen Platz machen musste. Ihr Material wurde aufgehoben und für den Bau der St. Johanniskirche in der Auguststadt, im Westen Wolfenbüttels, zur Verfügung gestellt.
Kirche im Tor - Trinitatis I

Nach Ende des dreißigjährigen Krieges 1648 wurde das Gotteslager durch eine neue Bastion östlich des Kaisertores verdrängt. Die verbleibenden Fachwerkhäuser aus dem wurden weiter östlich wieder errichtet. Die Kirche musste, wie schon erwähnt, der Bastion weichen und wurde im Westen Wolfenbüttels wieder aufgebaut. Am 13. Mai 1655 war der letzte Gottesdienst in der Fachwerkkirche, und am 20. Mai 1655 traf man sich dann das erste Mal zum Gottesdienst im neuen Andachtsraum des verlassenen und somit eigentlich überflüssig gewordenen Kaisertores. Der Andachtsraum war im großen Saal im ersten Stock des Kaisertores eingerichtet worden.
Jedoch war das kein guter Ersatz. Die Gemeindeglieder mussten durch das Herzogtor zur Kirche, denn der direkte Zugang von Osten her war durch die neue Bastion verwehrt.
Dennoch gewöhnte man sich an diese Situation, zumal die Mittel fehlten, eine eigene, neue Kirche zu erbauen. Das Kaisertor hatte robuste Grundmauern und bot zunächst mit seiner Kapazität von rd. 350 Sitzplätzen ausreichend Platz.
In den unteren Räumen, die für den Gottesdienst unbrauchbar waren, hatte die Garnison Platz zur Unterbringung ihrer Soldaten, von Werkstätten und Lagerräumen.
1691 kamen rund 400 Menschen regelmäßig zum Gottesdienst, es mussten also immer einige stehen. Die Gemeinde wuchs, und es wurde klar: ein größerer Gottesdienstraum musste gefunden werden. Herzog Anton Ulrich schrieb am 6. Mai 1692 eine Kollekte für einen Neubau aus und stiftete selbst 1000 Taler. Dazu kamen weitere 993 Taler, was für einen neuen Kirchbau nicht ausreichte. Man besann sich der guten Bausubstanz des Kaisertores und beschloss einen Umbau, der das ganze Obergeschoss umschloss und mit Emporen dann wesentlich mehr Platz bieten würde. Denn bis dahin hatte der Andachtsraum nur etwa die Hälfte des Grundrisses des Kaisertores eingenommen.
Johann Balthasar Lauterbach, Professor der Mathematik an der Wolfenbütteler Reiterakademie und herzoglicher Landbaumeister, stellte den Entwurf fertig und gab dabei der Westfassade ein prunkvolles Aussehen, so wie es dem Herzog Anton Ulrich gefiel, der gerne etwas für die Verschönerung des Stadtbildes tun wollte. Zwei große Türme, die das Gebäude selbst nicht überragen, umrahmen den Bau, die Fassade selbst lehnt sich an an die Fassade des Lustschlosses in Salzdahlum.
Als Lauterbach im Jahre 1694 starb, geriet der Umbau allerdings ins Stocken, auch weil die Mittel knapp wurden und der ursprünglich in Stein geplante Bau kaum hätte fertig gestellt werden können. Zwar hielt die Gemeinde ihren Gottesdienst in St. Marien, dieser Zustand hielt aber schon drei Jahre an. Aus diversen Gründen zogen sie jetzt in das Hochzeitshaus der Bürgerschaft in die herzogliche Komisse, um ihre Gottesdienste zu halten, und man rief 1698 erneut zu einer Kollekte auf, die von seiten der Gemeinde nur 378 Taler erbrachte. Allerdings gab Herzog Anton Ulrich mit seinen Söhnen noch einmal 1600 Taler dazu, so dass der Bau fortgeführt werden konnte.
Der neue Landbaumeister Hermann Korb setzte nun die Entwürfe in Holz um, was ihm leicht fiel, da er aus dem Tischlerhandwerk kam und so mit diesem Baustoff umzugehen wusste.
St. Trinitatis I

Am 1. Januar 1700, dem "Jubeljahr", wurde die Kirche geweiht. "Hic doums dei et porta Coeli" - Hier ist das Haus Gottes und das Tor zum Himmel, so stand auf der Medaille, die in diesem Jubeljahr mit dem Abbild der Kirche geprägt wurde. Vielleicht war die Wahl dieses Wortes ein Versuch, protestantische und römische Christen wieder zusammen zu führen, denn dieses Jakobswort (Gen 28, 17) stand auch auf päpstlichen Denkmünzen. Jedenfalls stand Herzog Anton Ulrich den Kreisen nahe, die eine Union beider Konfessionen anstrebten. Vielleicht aber will damit auch nur die Umwidmung des Stadttores zur Kirche markiert und betont werden: jetzt ist es kein Stadttor mehr, jetzt ist das Tor zum Himmel!
Der Name der Kirche, St. Trinitatis, ist neutral und hält die Möglichkeit einer Union protestantischer und römischer Christen offen.
Der Brand und die Bergkirche
Die Freude über das neue Gotteshaus auf den Grundfesten des alten Stadttores währte nicht lange. am Donnerstag, den 18. August 1705, traf ein Blitz die Kuppel und entzündete den Holzbau. Zunächst fürchtete man, dass durch Funkenflug das nicht weit entfernte, im Norden liegende Gießhaus der Garnison, in dem Schießpulver, Bomben und Granaten lagerten, entzündet würde. Doch dann drehte der Wind Richtung Osten, und die Häuser der Gottesstadt lagen weit genug entfernt, als dass der Brand eine Gefahr darstellte.
Weil die Balken und Säulen aber sehr massiv waren und man den Brand wegen der Höhe des Gebäudes nicht löschen konnte, holte man Kanonen heran und ließ den schwelenden Bau niederschießen. So schützte man die umliegenden Gebäude.
Nach fünf Wochen wird wieder Gottesdienst gehalten, diesmal in beengten Verhältnissen in der Werkstatt der Garnison im Gießhaus nördlich von der abgebrannten Kirche gelegen. "Der angebrannte Zorn Gottes" heißt die Predigt des Pfarrers Nitsch. Am 10. Sonntag nach Trinitatis, dem Sonntag vor dem Brand, hatte er in der Kirche eine Strafpredigt gehalten, dass Wolfenbüttel das gleiche Schicksal ereilen werde wie einst Jerusalem, da die Stadt in den gleichen Sünden leben würde. Nun war diese Predigt gerade im Blick auf das Gotteshaus wahr geworden.
Die künftigen Gottesdienste wurden im Gießhaus auf dem Philippsberg gehalten, dort, wo jetzt das Gefängnis steht. "Bergkirche" nannte man wegen ihrer erhöhten Lage diesen Notbehelf, und 14 Jahre versammelt sich dort die Gemeinde. Das Gotteslager ist arm, es findet sich nicht genug Geld, um St. Trinitatis wieder aufzubauen.
Da aber auch im Norden der Stadt ein neues Siedlungsgebiet vor allem von Gärtnern und Hofleuten entsteht, wird der Plan gefasst, anstatt nun eine Kirche im Gotteslager am Ostrand der Stadt wieder die alte Kirche auf den Grundmauern des Kaisertores zu errichten. So entsteht "St. Trinitatis II".
Die heutige Kirche St. Trinitatis - St. Trinitatis II

Das größte Problem stellte wieder einmal der Geldmangel dar. Nicht nur, dass die Gemeinde kaum die Mittel für einen Neubau hätte aufbringen können: die Liebäugelei des Herzogs Anton Ulrich mit der römischen Kirche führte schließlich dazu, dass er selbst übertrat und somit keine Unterstützung für die lutherischen Gemeinden mehr zu erwarten war. Einen Prunkbau errichtete sich der Herzog mit der Wolfenbütteler Bibliothek und ließ den notwendigen Bau der Trinitatiskirche hintan stehen.
Sein Sohn und Nachfolger August Wilhelm nahm 1716 den Plan des Wiederaufbaus auf und beauftragte Hermann Korb mit der Durchführung. Vorhandene Bauteile wurden wieder benutzt, um den Bau so kostengünstig wie möglich zu halten. Die steinernen Türme standen und bildeten den Rahmen des neuen Entwurfs. Ebenso standen drei Seiten der Umfassungsmauern des Tores, aber die Gewölbe des Tores im Erdgeschoss waren durch den Brand zerstört und beseitigt worden.
Nur der Außenbau wurde aus Stein gefertigt, innen kam Holz zur Anwendung. So waren wenigstens die Mauern vor Brand geschützt, aber im Grunde wurde mit geringen Mitteln großer Glanz vorgetäuscht.
7326 Taler standen Hermann Korb zur Verfügung, und er hat eine großartige Kirche daraus geschaffen. Zwei Emporenreihen schaffen genug Platz selbst für weit über 1000 Gottesdienstbesucher. Zehn massige Säulen, jeweils aus vier Tannenstämmen zusammengefügt und verschalt, stützen das Gewölbe, das aus Latten und Gips gefertigt ist.
Der neue Bau wurde am 1. Sonntag im Advent 1719 eingeweiht, obwohl er noch nicht ganz fertig war. Erst 1757 erhielten die Türme den letzten Schliff, und auch die Umrahmung der Kanzel von Johann Jürgen Reupke fand erst später die Gestalt, die sie heute hat.
Das Innere der Kirche war buntbemalt, worin sich die Sinnenfreudigkeit des Barock Ausdruck verschaffte. Diese Bemalung findet sich heute nicht mehr; nur der Eindruck von erhabener Größe, der den Besucher beim Betreten der Kirche überkommt, ist aus den ersten Jahren erhalten geblieben.