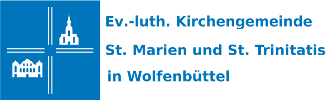Geschichte der Kirche
Beatae Mariae Virginis (BMV)
Die Geschichte der Hauptkirche BMV steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung Wolfenbüttels zur herzoglichen Residenzstadt. Östlich des Schlosses stand in einem versumpften Gelände einst eine kleine Marienkapelle, die 1301 erstmals urkundlich erwähnt ist. Von Herzog Heinrich d.J. 1533 zur herzoglichen Grablege ausgebaut, entstand an dieser Steile etwa ein halbes Jahrhundert später unter bewußter Beibehaltung des Namens die erste große protestantische Kirche nach der Reformation. Auslösend war ein Gesuch der "Prediger und Kirchenväter". mit dem sie am 9 Januar 1604 an den regierenden Herzog Heinrich Julius herantraten und auf die Notwendigkeit eines großen Kirchbaues für die Stadt Wolfenbüttel hinwiesen.Dem kunstsinnigen Regenten kam dieses Anliegen entgegen, da er bestrebt war, gleichzeitig eine neue würdige Grablege für die fürstliche Familie zu errichten.
Den Auftrag für die Planung erhielt als Krönung für sein Lebenswerk der herzogliche Baumeister Paul Francke. Nach schwierigen Vorarbeiten in morastigem Baugrund — durch den Einbau eines hölzernen Pfahlrostes — wurde 1608 der Grundstein gelegt. 16l3 waren die Arbeiten so weit fortgeschritten, dass der überraschend in Prag verstorbene Herzog Heinrich Julius in der neuen Fürstengruft beigesetzt werden konnte. Trotz einsetzender Wirren des dreißigjährigen Krieges wurden die Bauarbeiten bis zum Jahre 1624 weitgehend abgeschlossen, Es fehlten einige Zwerchhausgiebel und die Turmspitze. Das Notdach auf dem Turm wurde erst 1751 durch den heute vorhandenen barocken Turmhelm ersetzt, während Paul Francke einen wesentlich höheren, im Stil des übrigen Gebäudes gestalteten oberen Abschluß geplant hatte.
Für dieses erste "groß gedachte" Kirchengebäude des Protestantismus gab es keine Vorbilder Es sollte eine Predigt- und Abendmahlskirche zur Verkündigung des reformatorischen Glaubens für die Gemeinde werden, zugleich aber auch den Wunsch nach fürstlicher Repräsentation erfüllen. Paul Francke griff auf die gotische Konzeption der niederdeutschen Hallenkirchen zurück und überlagerte sie mit der aus dem Humanismus kommenden Kunst der ltalierier und mit der "Beschlag- und Knorpelwerkrenaissance" der Niederländer. Das nach eigener "Manier" im Kombinieren und Mischen gestaltete Gesamtkunstwerk stellt eines der wenigen Beispiele des Manierismus dar und kennzeichnet den Übergang von der Stilepoche der Renaissance zu der des Barock.

Der Baukörper besteht aus der dreischiffigen Halle, dem in die Westfassade eingerückten mächtigen Turm, einem vor die Ostseite der Halle gesetzten breiten Querriegel und der polygonalen Chorkapelle. Die Außenhaut wird durch Strebepfeiler geglieder, die zugleich Postamente für großplastische Darstellungen der Apostel und Evangelisten sind. Über den mit Knorpelwerk verzierten gotischen Maßwerkfenstern erheben sich unterschiedlich ornamentierte Zwerchhausgiebel. Etwa 800 reliefierte Quader an den Turmecken, am Langhaus und am Ostchor schmücken und gliedern die Fassaden. Sie enthalten zugleich ein ikonografisches Bildprogranmm, dass als "steinerne Predigt in redenden Denkbildern" gedeutet werden kann. Die Portale im Süden und Norden entstanden als beste Beispieie des Manierismus zur Erbauungszeit, während das Westportal — erst 1645 fertiggestellt — barocke Prächtigkeit ausstrahlt.Die Statuen von Moses und Aaron, darüber die der Herzöge Heinrich Julius und Friedrich Ulrich und in der Bekrönung die des segnenden Christus schuf der Lübecker Bildhauer Heinrich Gottes.
Die Turmvorhalle ist mit einem niedrigen Sterngewölbe überspannt. Von hier aus öffnet sich die große Halle, deren Erscheinung von mächtigen [ursprünglich schlanker geplanten) Achteckpfeilern bestimmt wird. Ornamentbänder und reich verzierte Kapitelle mit einer Vielzahl von Engelsköpfen leiten über zu den farbig ausgelegten Gurtbögen und den plastisch ausgeformten Rippen der Deckengewölbe.

An der Schwelle zum Chorraum ist die von Georg Steyger und Friedrich Greyss gestaltete Kanzel angeordnet. Die Figur des Moses mit den Gesetzestafeln trägt den Kanzelkorpus, während der Aufgang, der Korpus selbst und der Schalldeckel mit einem reichen plastischen Bildprogramm ausgestattet sind. Das Zentrum des Chorraumes bildet der ursprünglich für eine protestantische Kirche in Prag aus Holz geschnitzte Hochaltar des Freiberger Bildschnitzers Bernhard Ditterich. Die eindrückliche Darstellung des Passionsgeschehens mit dem siegreichen Gottessohn als obere Bekrönung hat dieses Werk zu einem hervorragenden Beispiel protestantischer
sakraler Bildkunst werden lassen. Weitere bedeutende Ausstattungsstücke sind das 1571 ehemals für die Schloßkapelle von Cordt Mente gegossene bronzene Taufbecken mit einem achteckigen schmiedeeisernen Gitter von 1722 und der mit zahlreichen musizierenden Engeln und vergoldetem Schleierwerk verzierte Orgelprospekt von Georg Huebsch und Friedrich Greyss, hinter dem sich ein 4-manualiges Orgelwerk mit 53 Registern verbirgt. Die Disposition für das 1619—1623 von Gottfried Fritzsche erbaute Instrument stammte von Hofkapellmeister Michael Praetorius, der unterhalb der Orgelempore bestattet worden sein soll.

Der große Kronleuchter wurde vermutlich Mitte des 16. Jhs. in Polen hergestellt und der Hauptkirche 1566 vom Herzogshaus gestiftet. Die Ausstattung des Kirchenraumes wird durch einen reichen Bilderschmuck sowie zahlreiche plastisch gestaltete Epitaphien und Grabplatten vervollständigt.
Unter Verzicht auf ein Querschiff ordnete Paul Francke im nördlichen Teil des Querriegels die Sakristei an und im südlichen die Gruftkapelle, von der aus die Fürstengruft mitt 29, z.T. kunstvoll verzierten Sarkophagen der herzoglichen Familie erschlossen wird.
Eine umfassende Sicherung und Restaurierung dieses bedeutenden Kulturdenkmals geschah von 1969 bis 1985. Es gelang aufgrund von intensiven Farbuntersuchungen, die historisch gesicherte Farbgebung des 17. Jhs. wiederherzustellen.
Über allem Planen und Bauen stand stets das Wort: SOLl DEO GLORIA
(Text: Klaus Renner - Bilder: Eigene)